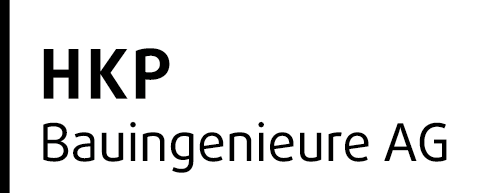Thermalbaden in Baden
Wie in den verschiedenen Medien berichtet wurde, ist das neue Thermalbad FORTYSEVEN in Baden von Architekt Mario Botta eröffnet worden. Aber nicht nur diese Bademöglichkeit wurde eröffnet, sondern auch zwei öffentlich zugängliche Thermalbadebrunnen: Die Heissen Brunnen in Baden und Ennetbaden.
Ausgangslage
In Baden und Ennetbaden wird mindestens seit römischer Zeit das mineralhaltige Thermalwasser genutzt. Heisse, unentgeltlich zugängliche Wasserbecken und Bäder im öffentlichen Raum waren – mit Ausnahme der letzten 150 Jahre – ein permanentes Element des Bäderbetriebs. Neue Heisse Brunnen sollen an dieses Erbe anknüpfen und die Kulturvermittlung in den Bädern unterstützen, indem das Thermalwasser 100% naturbelassen für alle Menschen im öffentlichen Raum zugänglich und wieder mit allen Sinnen erlebbar gemacht wird. Geplant und gebaut wurden zwei Heisse Brunnen, einer in Baden und einer auf der gegenüberliegenden Seite in Ennetbaden.
Trägerschaft
Die Machbarkeitsstudien wurden vom Verein Bagni Popolari aus Baden mit der Unterstützung von Fachleuten in grossen Teilen ehrenamtlich erarbeitet. Der Brunnen in Ennetbaden ist ein Projekt der Einwohnergemeinde Ennetbaden, die auch für den Unterhalt des Brunnens aufkommt. Der Brunnen auf der Badener Seite wurde durch die Ortsbürgergemeinde finanziert. Nach der Fertigstellung ging die Anlage an die Einwohnergemeinde Baden über, welche nun auch für den Betrieb und Unterhalt des Brunnes verantwortlich ist.
Der Brunnen besteht aus drei abgestuften Becken mit ebenfalls abgestuften Wassertemperaturen. Um eine zwängungsfreie und wasserdichte Betonkonstruktion zu erhalten, wurde die entsprechende Mindestbewehrung gemäss SIA 262 verbaut und die gesamte Konstruktion verschieblich gelagert. Das Badener Thermalwasser zeichnet sich aufgrund seiner hohen Anteile an natürlichem Chlorid und Schwefel als ausgesprochen aggressives Milieu gegenüber verschiedenen Materialien aus. Besonders betroffen sind dabei Metalle und Mörtel/Zemente.
Die drei Becken wurden aus einem speziellen Kalksteinbeton gefertigt. Damit der Beton der chemischen Belastung langfristig widerstehen kann, war eine spezielle Rezeptur nötig. Folgende Betoneigenschaften wurden definiert: C25/30; XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH); Dmax 45 mm; Cl 0.1; F4.
Als Bewehrungsstahl kam ein Stahl mit der Qualität Top 12 zum Einsatz, die Schraubanschlüsse bestehen aus INOX, wobei das wasserseitige Eisen zusätzlich mit Epoxidharz beschichtet wurde.
Der Heisse Brunnen auf dem Ennetbadener Limmatplatz ist ein Brunnen im herkömmlichen Sinn. Pumpenlos gespeist mit Thermalwasser der Schwanenquelle, werden die Brunnen auf dem Limmatplatz konstant von naturbelassenem, reinem Quellwasser durchströmt. Zuerst wir der Trinkbrunnen am Eingang gespiesen. Das Wasser fliesst weiter zum grossen Badebrunnen, auf dem Weg zurück zum Fussbad, wird ein Stück des Sitzbankes durch das Thermalwasser aufgewärmt.
Der Trinkbrunnen und der grosse Badebrunnen bestehen aus einem gehauenen Muschelkalk, das Fussbad und die angrenzenden Stahlbetonbauteile wurden analog dem Brunnen auf der Badener Seite konstruiert. Einziger Unterschied beim Beton ist der Verzicht auf das gebrochene Kalksteinmaterial bei den Zuschlagstoffen.
Die Anlage wird durch die bestehende Stützmauer eingefasst. Damit der Badebereich von der Strassennutzung abgetrennt ist, wurde die Stützmauer um die aufgesetzte Strassenbrüstung erhöht. Die alte Oberfläche der Stützmauer wurde durch den Auftrag einer Spritzbetonschicht saniert.